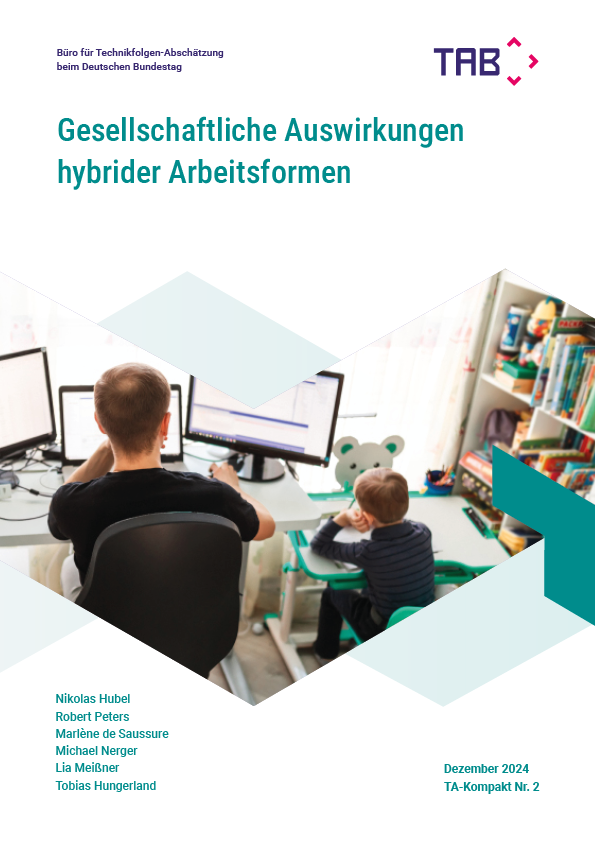Gesellschaftliche Auswirkungen hybrider Arbeitsformen
- Projektteam:
- Themenfeld:
- Themeninitiative:
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung
- Analyseansatz:
- Starttermin:
2023
- Endtermin:
2024
Die TA-Kompakt-Studie wurde vom Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung am 4. Dezember 2024 abgenommen und am 30.01.2025 als TA-Kompakt Nr. 2 veröffentlicht.
In Kürze
Die COVID-19-Pandemie hat in Deutschland zu einer starken Zunahme hybrider Arbeitsformen geführt. Die bislang bestehende Studienlage gibt zwar fundierte Einblicke in Hintergründe, Formen und erste sich abzeichnende Folgen hybrider Arbeitsformen, dennoch ergeben sich aus Perspektive der Technikfolgenabschätzung noch Erklärungs- und Wissenslücken.
Wie haben sich die Verbreitung und die Nutzung hybrider Arbeitsformen seit der COVID-19-Pandemie in Deutschland verändert und welche weitere Entwicklung ist zu erwarten?
- Nach der COVID-19-Pandemie zeigt sich in Deutschland eine weiterhin relevante, wenn auch im Vergleich zur Hochphase der Pandemie reduzierte Nutzung hybrider Arbeitsformen, wobei sektorale Unterschiede bestehen.
- Hybride Arbeitsformen werden sich in Zukunft vermutlich weiter etablieren. Expert/innen erwarten eine Verbreitung über verschiedene Branchen hinweg, wobei Technologien wie digitale Kollaborationsplattformen sowie neue Führungsstile und Unternehmenskulturen als entscheidend für den Erfolg dieser Arbeitsmodelle angesehen werden.
Wie wird hybride Arbeit von Arbeitnehmer/innen und Arbeitgebern bewertet? Inwieweit verändert sich die Attraktivität der Arbeitsform und wodurch wird diese beeinflusst?
- Die Mehrheit der Erwerbstätigen steht hybrider Arbeit positiv gegenüber. Geschätzt werden u. a. die bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, die Reduktion von Pendelzeiten und ein höheres Maß an zeitlicher Selbstbestimmung.
- Arbeitgeber konnten anfängliche Skepsis gegenüber Homeoffice durch positive Erfahrungen abbauen. In einigen Bereichen wird jedoch nach wie vor großer Wert auf Präsenz am Arbeitsplatz gelegt.
- Die Ausgestaltung und die Akzeptanz hybrider Arbeitsformen variieren stark zwischen den Branchen.
- Die zukünftige Verbreitung hybrider Arbeit wird wesentlich davon abhängen, wie die Rahmenbedingungen für hybride Arbeit von Arbeitnehmer/innen und Arbeitgebern angenommen und gestaltet werden.
Welche gesundheitlichen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen hybrider Arbeit sind bekannt und absehbar?
- Hybride Arbeit kann sowohl negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit haben, z. B. ergonomische Probleme und erhöhter Produktivitätsdruck, als auch positive Effekte wie eine verbesserte Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und reduzierte Pendelzeiten.
- Die zunehmende Verbreitung hybrider Arbeitsmodelle verändert die Arbeitsorganisation und -kultur, indem sie die Kommunikation erschwert und den Bedarf an gezieltem Wissens- und Kompetenzaustausch sowie an der Nutzung digitaler Kollaborationswerkzeuge erhöht.
- Hybride Arbeitsformen können die Kostenstruktur von Unternehmen beeinflussen, indem sie langfristig zu Einsparungen bei Büroflächen führen, wobei sie kurzfristig Investitionen beispielsweise in digitale Technologien erfordern.
- Gesellschaftlich bergen hybride Arbeitsformen das Risiko, soziale Ungleichheiten und Polarisierungen zu verstärken. Zugleich können aus dem reduzierten bzw. räumlich veränderten beruflichen Pendelverkehr von Fachkräften positive Umwelteffekte generiert werden.
Welche Faktoren sind für eine positive Entwicklung hybrider Arbeit, von der sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer/innen profitieren, relevant?
- Eine erfolgreiche Ausgestaltung der hybriden Arbeitswelt erfordert betriebliche Anpassungen in der Arbeitsorganisation und Personalführung. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer/innen bei diesen Veränderungsprozessen ist sinnvoll.
- Die Rolle des Staates wird vor allem in der Bereitstellung grundlegender sozialer Infrastruktur gesehen, während weitere gesetzliche Regelungen und finanzielle Unterstützung als weniger prioritär betrachtet werden.
- Technologische Innovationen spielen eine zentrale Rolle, insbesondere für Branchen, die bisher weniger von hybrider Arbeit profitieren. Beispielsweise könnten KI-gestützte Anwendungen in Zukunft dazu beitragen, dass bisher ortsgebundene Tätigkeiten verstärkt hybrid ausgeführt werden.
- Zur Förderung einer positiven Gestaltung hybrider Arbeit sind Maßnahmen zur Schaffung sozialer Begegnungsräume sowie kontinuierliche Weiterbildungsformate für die effektive Nutzung neuer Technologien und sozialer Praktiken erforderlich.
Welche Fragen sollten wissenschaftlich vertieft werden, um einen möglichst fundierten Diskurs über die Gestaltung hybrider Arbeit führen zu können?
- Es fehlen wissenschaftliche Erkenntnisse zu der Frage, inwieweit sich hybride Arbeitsformen in Branchen mit hohem Anteil von Interaktionsarbeit und in gewerblich-technischen Berufen signifikant ausweiten lassen und ob es langfristig prinzipielle Grenzen für die Etablierung hybrider Arbeit gibt.
- Ob technologische Innovationen wie Robotik und Mixed-Reality-Technologien langfristig relevante Beiträge zur Gestaltung hybrider Arbeit leisten können, bleibt offen und bedarf weiterer Forschung.
- Weitere Studien sollten klären, wie informeller Austausch digital besser realisiert werden kann und ob der digitale Austausch vergleichbare psychologische Effekte wie persönliche Begegnungen erzielen kann.
- Es ist notwendig, die Faktoren, die die Akzeptanz hybrider Arbeit durch Arbeitgeber beeinflussen, sowie die geschlechtsspezifischen Auswirkungen hybrider Arbeit auf die Verteilung von Betreuungsarbeit, psychische Gesundheit und Karrierechancen zu untersuchen.
Methodisches Vorgehen
Die Studie stützt sich auf eine umfassende Auswertung der aktuellen Literatur sowie 14 ergänzende Interviews mit Expert/innen bzw. Akteur/innen aus Wissenschaft und Verbänden zu den oben genannten (Leit-)Fragen. Aufbauend auf den Zwischenergebnissen wurde vor der Berichtserstellung zusätzlich eine zweistufige Delphi-Befragung zur Abschätzung zukünftiger Entwicklungen und Auswirkungen hybrider Arbeitsformen mit einem Expertenpanel aus Vertreter/innen von Wissenschaft, Unternehmen und Gewerkschaften durchgeführt.
Download
|
TA-Kompakt Nr. 2 Gesellschaftliche Auswirkungen hybrider Arbeitsformen (PDF)
Die Studie schafft einen aktuellen Überblick über die bisher vorliegende wissenschaftliche Evidenz zur Verbreitung und zu den Auswirkungen hybrider Arbeit, bewertet Erkenntnislücken und bestehende Differenzen im wissenschaftlichen Diskurs und leitet daraus resultierende politische Handlungsoptionen ab. Sie bietet eine kompakte Darstellung des gegenwärtigen Stands der wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Debatte und eine Abschätzung möglicher künftiger Entwicklungen. Dabei werden sowohl die kurzfristige (bis 2025) und die mittelfristige (bis 2030) Entwicklung hybrider Arbeitsformen und deren Folgen betrachtet. |
In den Medien
-
heise.de (03.02.2025), Technikfolgenabschätzer: Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben
Frühere Publikation zum Thema
|
Themenkurzprofil Nr. 41 Perspektiven eines hybriden Arbeitens im Homeoffice und im Büro (PDF) |